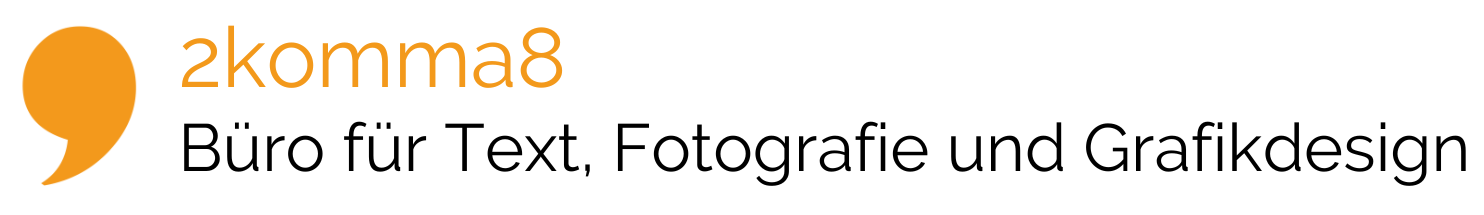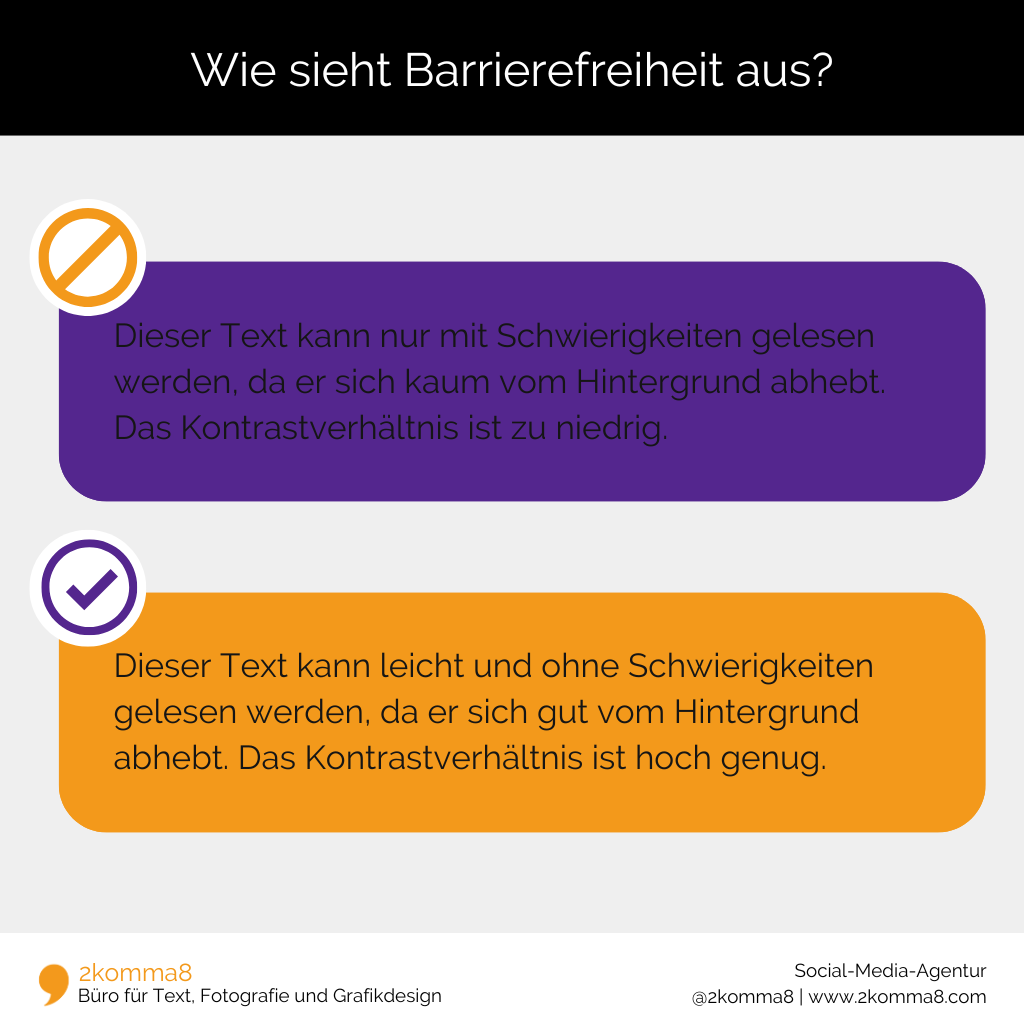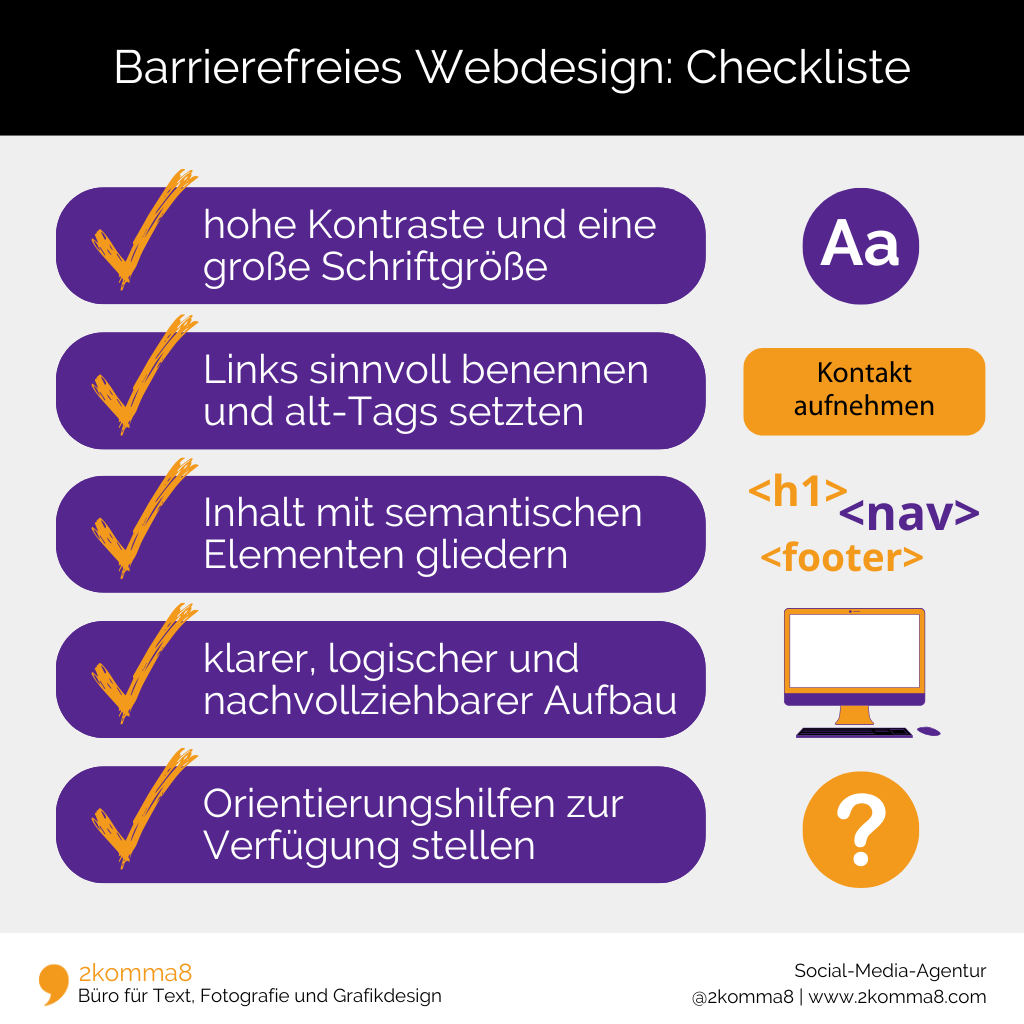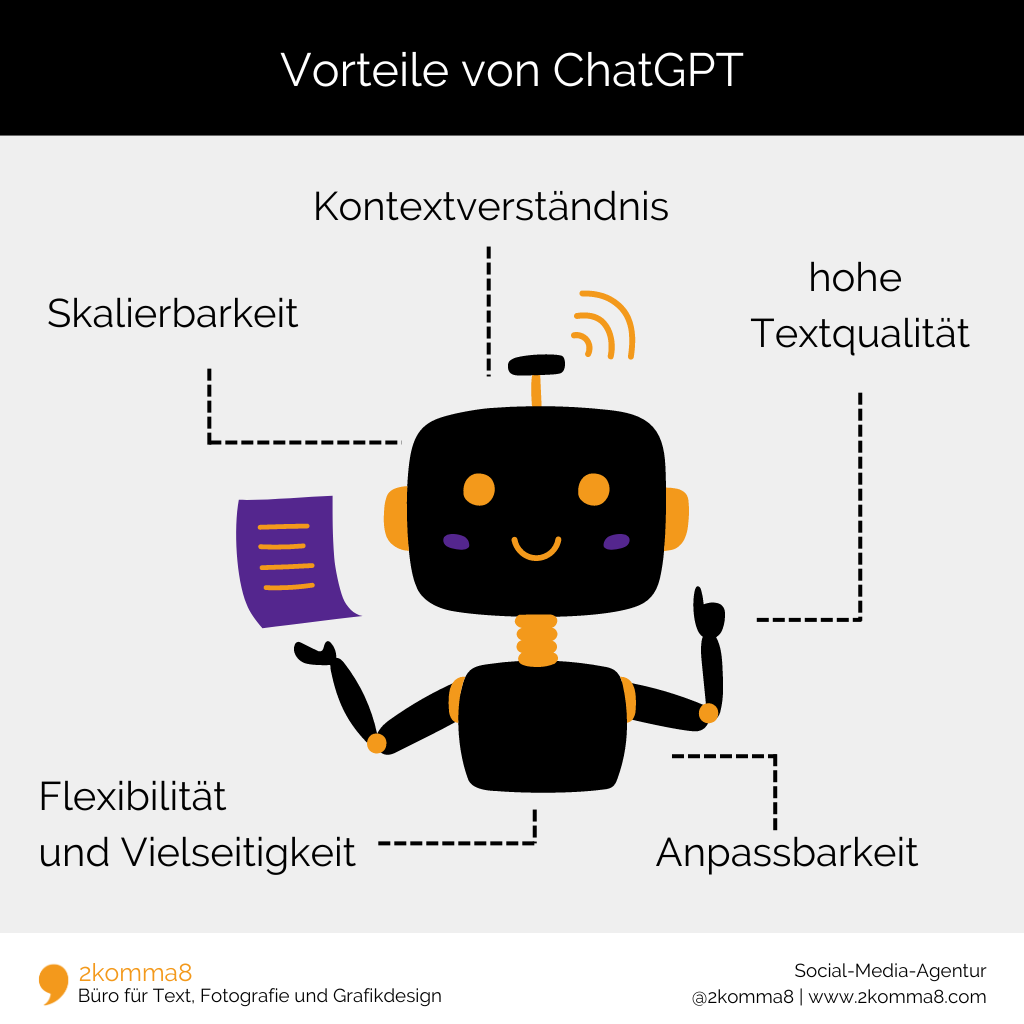Nice oder No-Go? Anglizismen in der deutschen Sprache unter der Lupe
„Anglizismen sind für mich ein No-Go“, sagt der Comedian Torsten Sträter – und nutzt dabei im selben Satz augenzwinkernd selbst einen. Ein geschickt gewähltes sprachliches Paradoxon, das uns schmunzeln lässt und zugleich einen tieferen Einblick in die Realität unserer modernen Sprachwelt offenlegt. Wie viel Wahrheit steckt in dieser Aussage? Sind Anglizismen eine Bereicherung oder verwässern sie unsere Sprache? Willkommen zu einer Reise durch die Deutsch-Englische-Sprachwelt, gespickt mit Anglizismen, bei der wir uns die Geschichte und die vermeintlichen Vor- und Nachteile genauer ansehen.
Die Wurzeln der Anglizismen
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Die deutsche Sprache hat sich schon immer gewandelt. Wie ein Fluss, der neue Zuflüsse aufnimmt, wird sie durch Worte aus anderen Kulturen schon seit Jahrhunderten bereichert und gestaltet. Anglizismen sind kein modernes Phänomen. Doch mit der Geschichte Deutschlands, der Globalisierung, dem Internet und der Dominanz der englischen Sprache in Medien, Technologie, Wissenschaft und Wirtschaft hat der Einfluss in alle Lebensbereiche hinein enorm zugenommen.
Schon im Alltag begegnen uns Begriffe, über die wir nicht einmal mehr als Anglizismen nachdenken und die unsere Großeltern schon weitergegeben haben. „Hobby“, „Camping“, „Disco“, „Jeans“, „Popcorn“ – und bei „Toast“ und „Cornflakes“ hören wir aus dem Radio gewohnt die neuesten ‚Hits‘. Und auch ich verwende hier im Text ebensolche, wie zum Beispiel Internet – statt „weltweites Netz“.
Die besondere Situation nach dem Zweiten Weltkrieg öffnete die deutsche Sprachlandschaft für neue Einflüsse. Nach 1945 hinterließ die alliierte Besatzung deutliche Spuren in der deutschen Sprache. Besonders die Amerikanisierung, die durch Soldaten, Filme, Musik und Werbung gefördert wurde, brachte eine Vielzahl englischer Begriffe mit sich.
- Sprache und Popkultur: Amerikanische Soldaten brachten nicht nur Coca-Cola und Jazz mit, sondern auch Begriffe wie „Jeep“, „Snack“ und „Club“. Diese wurden schnell Teil des deutschen Alltags.
- Medien: Amerikanische Filme, Serien und Musik wurden beliebt, was die Akzeptanz englischer Begriffe stark förderte. Worte wie „Star“, „Show“ oder „Hit“ stammen aus dieser Zeit.
- Militärische Begriffe: Einige Anglizismen wurden durch die militärische Präsenz der Alliierten eingeführt, z. B. „Checkpoint“ oder „Camp“.
Einflüsse aus Popkultur und Medien
Die US-amerikanische Lebensweise wurde zum Symbol für Freiheit und Fortschritt und führte dazu, dass Anglizismen schnell an Akzeptanz gewannen. Gleichzeitig beeinflussten die Alliierten durch ihre technologischen Innovationen die Sprache. Begriffe wie „Truck“ oder „Service“ aus der Automobilindustrie fanden ebenso Eingang in den deutschen Sprachgebrauch wie viele technische Neuerungen.
Auch das Bildungssystem spiegelte diesen Wandel wider, da Englisch zunehmend als erste Fremdsprache gefördert wurde. Zusätzlich etablierten sich durch Medien und Werbung Begriffe wie „Cornflakes“ oder „Fast Food“, die heute wie selbstverständlich klingen. Diese Entwicklungen zeigen, wie eng Sprache, Kultur, Lebensstil und Geschichte miteinander verbunden sind.
Die Unterhaltungsindustrie, insbesondere die Musikszene, hat seit der Mitte des 20. Jahrhunderts massiv dazu beigetragen, englische Begriffe in unseren Alltag zu integrieren. Zum Beispiel wurden Wörter wie „Top Ten“ oder „Charts“ anstandslos in die Hitparade übernommen. Als außergewöhnlich beliebte Vertreter der Branche brachten spätestens die Beatles nicht nur den „Rock ’n’ Roll“ nach Deutschland, sondern auch englische Begriffe wie „Single“ oder „Song“. Die Disco-Welle der 1970er bis 1990er führte zu Ausdrücken wie „DJ“ und „Remix“. Hip-Hop brachte Wörter wie „Battle“, „Track“ oder „Flow“ in die Umgangssprache. Die Sprache der deutschen „Hits“ ist also Englisch?
Sidefact: Nicht so klar dominiert, wie oft vermutet wird! Nationale Single-Produktionen in den Top-100-Jahrescharts hatten 2023 einen Anteil von rund 58 Prozent, wie der Bundesverband für Musikindustrie (BVMI) berichtet.
Von „Rock ’n‘ Roll“ bis zu „Hip-Hop“ – englische Begriffe, die durch die Musikszene Einzug hielten, sind längst Teil unserer Alltagssprache geworden. Die internationale Musikindustrie erreichte immer größere Menschengruppen und insbesondere Jugendliche begannen Songtexte mitzusingen und fügten dabei spielerisch englische Wendungen ihrem deutschen Wortschatz hinzu. Musik wurde so – generationstransformierend – zum Sprachbotschafter.
Einflüsse aus Industrie und Wissenschaft
Mt der Einführung der Informationstechnologie in jeden Haushalt kam eine weitere Welle von Anglizismen. Die Sprache des Programmierens, die maßgeblich vom Englischen geprägt ist, brachte uns Begriffe wie „Computer“, „Software“ und „File“. Der Begriff „Computer“ ersetzte früh den deutschen Begriff „Rechenmaschine“. Mit der Einführung des Internets wurden Wörter wie „Login“, „Homepage“ und „Browser“ alltäglich. Die E-Mail (von „electronic mail“) wurde so selbstverständlich, dass kaum jemand die deutsche Wendung ‚elektronische Post“ benutzen würde. Begriffe aus der IT-Welt wurden schnell übernommen, da der technische Fortschritt primär im englischsprachigen Raum stattfand und es oft spontan keine einfachen deutschen Alternativen gab. Die digitale Revolution war nicht nur eine technische, sondern ebenso eine sprachliche.
Auch in der Wissenschaft prägen Anglizismen die Sprache und sind längst in unseren Alltag angekommen. Begriffe wie „Research“, „Double-Blind-Studie“, „Lockdown“ oder ‚Superspreader“ stammen aus wissenschaftlichen Kontexten und haben durch Medien und öffentliche Diskussionen starke Resonanz erhalten. Besonders während der COVID-19-Pandemie wurde deutlich, wie wissenschaftliche Fachsprache direkt unsere Kommunikation beeinflusst.
Warum wir Anglizismen lieben
Englische Begriffe sind aus unserer Sprache nicht mehr wegzudenken – sie klingen oft moderner, sind kürzer und transportieren ein internationales Lebensgefühl. Ob im Alltag, in den Medien oder im Marketing: Anglizismen machen vieles griffiger und cooler. Aber warum eigentlich? Ein Blick auf drei spannende Aspekte zeigt, warum wir so gern auf englische Wörter setzen:
- Kürzer, knackiger, cooler: Warum „Schlauchbootfahren“ sagen, wenn „Rafting“ so viel trendiger klingt? Warum „Elektroroller“ statt „E-Scooter“ oder früher einmal: „tragbarer Musikspieler“ statt „Walkman“? „Public Viewing“ klingt doch glamouröser als „Öffentliches Gucken“, oder? Anglizismen verleihen der Sprache oft eine moderne Note und wirken international.
- Flexibel und vielseitig: Das Englische kennt oft Wendungen und Begriffe, die im Deutschen entweder zu umständlich oder schlicht nicht vorhanden sind. „(…) der, die, das Fenster, such dir einen aus“, sagt die Comedian Tamika Campbell und spielt damit genau auf diese Umständlichkeit an. Warum nicht einen Artikel für alles benutzen? Oder nehmen wir den Begriff „Influencer“: „Beeinflusser“ würde zwar kaum jemand sagen, aber neben dieser Bedeutung schließt er Meinungsmacher, Trendsetter oder Ratgeber elegant mit ein.
- Marketing und Medien: Ob „Coffee to go“, „Sneaker“ oder „Event“ – englische Begriffe sprechen das Gefühl an, Teil eines globalen Lebensstils zu sein. Marken und Kampagnen setzen gezielt auf Anglizismen, um modern und international zu wirken. „Black Friday“ klingt eben reißerischer als „Rabatt-Freitag“. Auch Werbeslogans wie „Just do it“ oder „Think different“ entfalten ihre Wirkung durch die Kürze und Prägnanz des Englischen. Medien verbreiten Begriffe durch ihre Präsenz in Filmen, Serien oder Artikeln, sodass sie rasch Teil unseres Alltags werden.
Warum Anglizismen manchmal nerven
Doch so schön es klingt, manchmal übertreiben wir es auch. Warum nennen wir es „Sale“, wenn „Schnäppchenjagd“ doch viel aufregender klingt? Oder „After-Work-Party“, wenn „Feierabend-Bierchen“ doch genauso gut klingt – nur entspannter?
Und wer könnte die Verwirrung vergessen, als „Handy“ zum deutschen Begriff für Mobiltelefon wurde? Ein Begriff, der in der englischen Sprache so gar nicht existiert, dafür aber auf den ersten Blick viele Muttersprachler*innen in die Irre führt. Während die Deutschen den Begriff längst als selbstverständlich sehen, fragen sich britische Landsleute bis heute, warum bei einem Mobiltelefon eigentlich „praktisch zur Hand“ im Fokus liegt? Während uns das Wort „Handy“ längst ans Herz gewachsen ist, gibt es andere Anglizismen, die auf den ersten Blick vertraut wirken, aber mit einer völlig anderen Bedeutung übernommen wurden.
Ein „Oldtimer“ ist für uns ein schickes Auto, das an die 1970er erinnert – für einen Engländer jedoch der freundliche Rentner von nebenan. Solche Bedeutungsverschiebungen und das Wort „Handy“, können amüsieren, zeigen aber auch, wie kreativ wir mit Sprache umgehen. Kein Wunder, dass solche Bedeutungswechsel manchmal für ein Stirnrunzeln sorgen.
Deutsch für English-People – Missverständnisse garantiert
Hier kommt noch einmal Tamika Campbell ins Spiel. Die Comedian hält uns auf charmant-satirische Weise den Spiegel vor und zeigt, wie verwirrend die deutsche Sprache wirken kann. Sie scherzt: „Fahren sie gerade aus. (…) Ich dachte so oft, sind die Deutschen so dumm, dass sie das ‚aus‘ am Ende der Gerade gebraucht haben. Hatte derjenige nicht verstanden, wenn ich sage, fahren sie gerade, brauchtest du die Erklärung von gerade? Vielleicht hat jemand gesagt: Wie gerade? Gerade wie? Was meintest du genau mit gerade? Ach so! ‚aus‘, jetzt kapier’ ich’s! Oder hier: Ich wohne mit ihm zusammen. Kannst du mit ihm getrennt wohnen? (…) You don’t say in English: I live with him together. I live with him. Wir verstehen das (es) zusammen ist.“
Ihr Humor zeigt: Deutsche Redewendungen sind oft herzlich unsinnig, aber gerade das macht sie so liebenswert. Gleichzeitig zeigen sie, dass auch unsere Sprache nicht immer logisch ist. Und da wirken englische Wendungen manchmal wie eine Erlösung – klar, einfach und direkt.
Pro und Contra im Alltag
Ob im Büro, in der Werbung oder auf Social Media – Anglizismen polarisieren. Während die einen „Homeoffice“ als zeitgemäß empfinden, vermissen andere die vertraute Klangfarbe der deutschen Sprache bei neuen Begriffen wie „Meet“ oder „Team Call“. Doch diese etablieren sich oft schneller in unserem Alltag, als wir darüber nachdenken können, ob wir passende deutsche Alternativen bevorzugen würden. Die Dynamik des Wandels zeigt, wie sehr sich Sprache unserer Zeit anpasst – und uns manchmal überrascht. Fakt ist: Es gibt heutzutage keine klare Antwort darauf, wann ein Anglizismus passend ist und wann nicht. Er ist aber oft schon nicht mehr wegzudenken. Manchmal ist es noch eine Frage des persönlichen Geschmacks und immer weniger, eine der Sprachkompetenz.
Die goldene Mitte? Ein Blick in die Zukunft
Anglizismen haben unsere Sprache bereichert, ohne sie zu überlagern. Ein gesundes Gleichgewicht ist heute der Schlüssel – für mich als Musiker ist es so wie mit einem harmonisch abgestimmten Mischpult, bei dem wir nur die besten Töne aufdrehen.
Doch wohin führt uns das langfristig? Englisch wird von weit mehr Menschen auf der Welt gesprochen als Deutsch. Vielleicht entsteht ja bei uns eine Mischung aus Deutsch und Englisch? Gene Roddenberry, der Schöpfer von Star Trek, stellte sich mit seinem humanistischen Ansatz eine Zukunft vor, die sich auf das Verständnis und die Zusammenarbeit aller Menschen und Kulturen stützt. Vielleicht reden wir eines Tages fließend „Denglisch“ – und wir werden es nicht einmal bemerken.
Die deutsche Sprache hat sich stets verändert, und diese Veränderung ist Teil ihrer Identität. Offene Systeme überleben. Doch in einer Welt des Wandels stellt sich die Frage: Wo endet Identität, und wo beginnt die Offenheit für Neues? Sind wir auf dem Weg, globale Bürger*innen oder gar Kosmopoliten und Kosmopolitinnen zu werden, die sich mit einer Sprache der Verbindung ausdrücken? Vielleicht ist, was heute als Kontrast erscheint, morgen schon die lösende Harmonie.
Fazit:
Sprache ist wie ein Spiegel unserer Zeit – sie ist dynamisch, sie verbindet uns und manchmal bringt sie uns auch ins Grübeln. Ob „Sale“, „After-Work-Party“ oder „Fahren sie gerade aus“ – sie lebt, wandelt sich und bringt uns zusammen. Doch dieser Wandel fordert uns auch heraus. Wir sollten uns fragen: Wie können wir Sprache so gestalten, dass sie Brücken baut und nicht Mauern errichtet? Die Offenheit für Neues ist keine Bedrohung, sondern eine Chance, gerade in einer immer vernetzteren Welt.
Vielleicht liegt die Lösung in einem liebevollen Blick auf unsere Eigenheiten und einer Vision, die uns über Sprachgrenzen hinweg vereint. Schätzen wir die beachtliche Ausdruckskraft der deutschen Sprache und seien wir gleichzeitig Visionäre! Sprache kann uns verbinden, wenn wir sie mit Bedacht nutzen.
Der richtige Umgang mit Anglizismen
Ein pragmatischer Ansatz könnte sein: Passt der Begriff zur Zielgruppe und zum Textzweck? Wenn ja, warum nicht? Aus kultureller Perspektive belebt Sprache sich durch ihren Kontext – Anglizismen können Stil und Klarheit schaffen. Kreativität erlaubt uns sogar, eigene Begriffe zu formen, die modern und frisch wirken. Der Schlüssel ist immer, die Perspektive der Leser*innen einzunehmen: Werden sie den Begriff verstehen, oder schreckt er sie ab? Eine Mischung aus englischen und deutschen Begriffen bereichert, solange sie harmonisch bleibt. Lassen Sie uns daher nicht über richtige oder falsche Worte streiten, sondern überlegen, wie wir sie gemeinsam nutzen, um einander besser zu verstehen.
Coverbild: Photoboyko – Getty Images (Canva)
Unsere Lektor*innen helfen Ihnen gern, die Balance zu finden. Unser Ziel ist es, Texte klar, ansprechend und zielgruppengerecht zu gestalten – mit oder ohne Anglizismen.